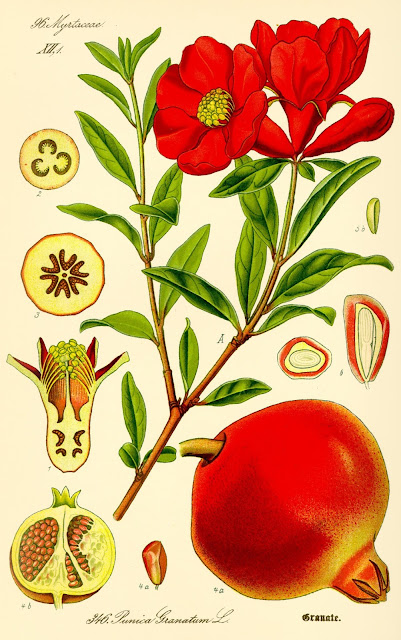Granada in
Andalusien, die Stadt unterhalb der Alhambra,
des einzigartigen
Juwels maurischer Architektur, ist auch sonst sehr reizvoll. Was
auffällt, dass ein Ornament überall auftaucht: der Granatapfel.
Gut, das mag naheliegend sein, wenn die Stadt schon so heißt.
Naheliegend auch, dass der Strauch überall im Stadtbild grünt und
blüht, dass es eine Pracht ist. Granada lässt keine Gelegenheit
aus, sich mit dem exotischen Gewächs zu schmücken.
Der
Granatapfelstrauch ist im Mittelmeerraum auch gar nicht so exotisch,
aber bei uns kennt man seit jeher eher den Namen als die Frucht; was
ist das eigentlich, der Granatapfel? Zunächst einmal: Es ist kein
richtiger Apfel. Der Apfel ist ein Rosengewächs, und der Granatapfel
gehört – trotz der prachtvollen, intensiv hellroten Blüten - zu
den Myrtengewächsen. Der Granatapfel ist relativ groß, schwer
(wiegt oft ein ganzes Pfund!) und ist von einer
ledrig-pergamentartigen Haut umgeben. Schneidet man ihn auf, zerfällt
er in hunderte (bis zu 400, sagt Wikipedia; andere sagen anderes)
maiskorngroße, saftige Fruchtkörper, durchscheinend, intensiv rot
und arg süß. Aus ihnen wird der Grenadinesirup (den kennen Sie vom
Tequila Sunrise) hergestellt, und zwar, indem man den Fruchtsaft 1:1
mit Zucker einkocht. Manchen Leuten kann es offenbar nicht süß
genug sein!
Früher wurde der
Granatapfel auch anderweitig verwertet: Die Blüten sind auch
getrocknet noch rot; im Aufguss als Gurgelwasser und gegen Durchfall
verwendbar. Wurzelrinde
hilft gegen Bandwürmer. Die Schale des 'Apfels' wurde gern zum
Färben von Textilien (z.B. Teppichen) verwendet: nicht rot, sondern
braun bis schwarz. Darüber hinaus und vor allem war die Frucht
geradezu kulturübergreifend symbolträchtig; die Bibel erwähnt sie
mehrfach, ebenso der Koran. Der Granatapfel war ein Symbol des
Lebens, der Lebens- und Sinneslust und der Fruchtbarkeit. Der Apfel
des Paris (den er Helena zusprach) war ein Granatapfel. Andererseits
stand der Granatapfel im Mittelalter auch für die Welt (den
'Erdapfel' – von wegen, die Erde sei eine Scheibe!) - der
Reichsapfeli
war auch ein Granatapfel.
Warum aber
'Granat-'? Hat das was mit Granate zu tun? Doch wohl eher mit dem
Granatschmuck? Wer im Lateinunterricht mehr mitbekommen hat als die
blutrünstigen Eroberungen Caesars mag irgendwann auf das lateinische
Wort für 'Korn' gestoßen sein: granum. Das bedeutet außerdem
'Samen' und 'kleiner Kern', und da ein Körnchen sehr wenig wiegt,
nennt sich auch ein Apothekergewicht gran. Ein gran
sind etwa 65 mg. Das granum steckt auch in 'filigran',
im englischen grain (nicht aber in Migräne!) und schon auch
in der Granate. Eine Granate ist ein mit Sprengstoff gefülltes
Artilleriegeschoss (die meisten werden eher die Handgranate kennen),
und da der Granatapfel mit diesen kleinen Früchtchen gefüllt ist,
war das ganz offensichtlich granatum, also 'gekörnt'. Zu den
Namen der Frucht gleich noch mehr.
Interludium.
Ein Granatsplitter ist zum einen ein Teilstück einer explodierten
Granate, zum anderen ein Konditorei-Objekt. Aus den bei der
Herstellung von Torten und Biskuitrollen anfallenden Resten wird
durch Zugabe von Buttercreme, Kakao und Rum ein Haufen geformt und
mit Kuvertüre überzogen. Nicht unbedingt ein großer
Schlankmacher...Klingt nur etwas martialisch in unseren (gottseidank)
eher friedlichen Zeiten. Versuche, den Namen zu ändern – etwa in
'Bärenhaufen' – sind bisher gescheitertii.
Wir können jedoch beruhigt feststellen, dass der Granatsplitter nur
sehr indirekt mit dem Granatapfel verwandt ist. Auch mit dem
körnigen, sehr harten Schmuckstein namens Granat ( engl. garnet,
frz. grénat mittelhochdeutsch grānāt , von
mittellateinisch [lapis]granatus 'körniger [Stein]') ist die
Verwandtschaft nur oberflächlich, obwohl die roten Fruchtkörperchen
des Granatapfel schon etwas an rote Granatsteine erinnern (letzterer
heißt im Deutschen auch Karfunkel).
Doch nun zu den
Namen unserer Frucht:
Die Römer nannten
sie malus punica, punischer Apfel. Nun waren die Punier, auch
Phönizier (und später auch Karthager) genannt ja so etwas wie der
Erzfeind Roms; ergo muss sich 'punisch' auf die vermeintlich
exotische Herkunft bezogen haben, also den vorderen Orient, die
Heimat der Punier (oder, wie manche meinen, Nordafrika – wegen
Karthago). Der wissenschaftliche lateinische Name ist punica
granatum: auch hier sind Phönizier versteckt. Auf französisch
grenade und auf spanisch granada genannt, heißt der
Granatapfel pomegranate. Das pome- entspricht natürlich
dem französischen pomme, 'Apfel'. Nun hieß ja in früheren
Zeiten so manches 'Apfel' iii,
das wir etwas differenzierter sehen: Birnen, Quitten, ja die
Apfelsine (-sine heißt hier 'aus China') oder der Pfirsich (urspr.
malum persicum = persischer Apfel), und schließlich auch
etwas so wenig apfeliges wie der Erdapfel (a.k.a. Grundbirne: die
Kartoffel). Gut, aber warum pomme? Das ist mehr oder weniger
die römische Göttin des Obst- und Gartenbaus selbst: Pomona. Wenn
Sie von ihr noch nicht viel gehört haben – auch sie kommt in
Caesars De Bello Gallicoiv
nicht vor...
 |
| Pomona. Gemälde von Fouché |
iWie
die Reichskrone und das Szepter war der Reichsapfel Teil der
Reichsinsignien.
ii
'Bärendreck' gibt’s aber!
iii
Wortgleich in vielen Sprachen, so germ. apfel, apple,
isl epli; slaw (russ.). яблоко; kelt
(walisisch). afal; balt. (litauisch) obelis, aber
nicht in romanischen Sprachen: lat. malus; span. manzana
(indirekt auch von lat. malus) und frz. pomme =>
'Apfel' einheimisch nördlich der Alpen
iv
Das Buch heißt nicht: "Über den schönen Gallier"
– Caesar ist im Krieg.